Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Blindenschrift: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Was ist die Blindenschrift?
Bei der Blindenschrift handelt es sich um Schriftsysteme, die durch das Tasten mit dem Finger inhaltlich erschlossen werden können. Auf diese Weise können auch Menschen, die ihre Augen nur noch teilweise oder gar nicht mehr verwenden können, Lesen und Schreiben lernen. Die bekannteste und meist verwendete Blindenschrift ist die Brailleschrift, welche 1845 in Frankreich entwickelt wurde.
Welche Arten von Blindenschrift gibt es?
Unter dem Begriff Blindenschrift werden alle Schriftsysteme zusammengefasst, die ohne das Sinnesorgan Auge gelesen werden können. Neben der weit verbreiteten Brailleschrift gibt es also noch mehr solcher Blindenschriftarten, die heute teilweise mehr und teilweise weniger genutzt werden. Man unterscheidet zunächst die Relief- und die Punktschrift.
Reliefschrift: Die Schriftzeichen bestehen aus geprägten Buchstaben oder geometrischen Figuren.
- Moonalphabet (bekannteste Reliefschrift, besteht aus einfachen geometrischen Figuren, 1845 von Dr. William Moon entwickelt)
- Stachelschrift (Darstellung der lateinischen Buchstaben in Punkten, 1807 von Johann William Klein erfunden)
- Haüy-Alphabet (erhaben und geschwungen dargestellte Buchstaben, 1784 von Valentin Haüy entwickelt)
Punktschrift: Die Schrift besteht ausschliesslich aus Punkten ohne visuelle Funktion.
- Nachtschrift (System aus zwölf tastbaren Zeichen, von Charles Barbier de la Serre)
- Brailleschrift (Weiterentwicklung der Nachtschrift, bestehend aus sechs Punkten, 1825 von Louis Braille)
- Computerbraille/Eurobraille (8-Punktesysteme, speziell für die Arbeit am Computer entwickelt)
Wie werden bei der Punktschrift bzw. Brailleschrift die Buchstaben in Punkte übersetzt?
Ein Schriftzeichen in der Brailleschrift wird immer auf einem Raster aus 3 Zeichen in der Höhe und zwei Zeichen in der Breite dargestellt. Durch die möglichen Kombinationen aus gestanzten und nichtgestanzten Punkten ergeben sich insgesamt 64 verschiedene Variationen, die jeweils ein Zeichen darstellen. Nur ein Punkt oben links steht beispielsweise für ein A, ein Punkt oben links und ein Punkt mittig links ergibt ein B. Diphthonge wie „ei“ oder „au“, sowie „ch“, „sch“ und „st“ haben in der deutschen Sprache darüber hinaus ihre eigenen Braillezeichen. Ein Unterschied zwischen Gross- und Kleinbuchstaben wird bei der Brailleschrift nicht gemacht. Alle deutschsprachigen Länder folgen dabei den Regeln der 1998 beschlossenen Reform der deutschen Blindenschrift. Andere Sprachen haben für die Brailleschrift ihre eigenen Reformen und Regeln, sofern sie sie verwenden.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
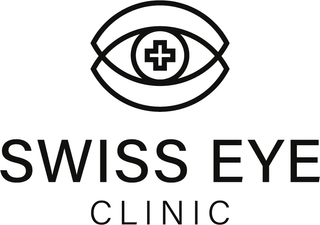 Zürich
ZürichSwiss Eye Clinic
Dufourstrasse 47, 8008 ZürichSwiss Eye Clinic wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet51 Bewetungen0449... Nummer anzeigen 044 923 04 04 * -
 Winterthur
WinterthurAugenzentrum Winterthur
Lagerhausstrasse 10, 8400 WinterthurAugenzentrum Winterthur wurde mit 3.7 von 5 Sternen bewertet3.73 Bewetungen0522... Nummer anzeigen 052 213 38 00 * -
 Zürich
ZürichVista Augenklinik Seefeld
Holbeinstrasse 25, 8008 Zürich0 Bewetungen0442... Nummer anzeigen 044 266 60 90
Wie werden bei der Punktschrift bzw. Brailleschrift Symbole und Zeichen übersetzt?
Die meisten Symbole, Zeichen und Sonderzeichen haben genau wie die Buchstaben eine direkte Zuordnung zu einer Punktkombination. Nur wenige Zeichen wie beispielsweise das Plus und das Ausrufezeichen sind doppelt belegt. Ausserdem entsprechen die Braillezeichen der ersten 10 Buchstaben des lateinischen Alphabets jeweils den Zahlen von 0 bis 9, wobei das A der 1 entspricht und das J der 0. Für die Verwendung der Brailleschrift in der Mathematik wurde eigens ein System entwickelt, das auch Mathematikschrift genannt wird. Auch gibt es eine festgelegte Schreibweise von Ordnungszahlen, Datumsangaben, Brüchen und ähnlichen zahlenbasierten Angaben. Da für die moderne Computersprache wesentlich mehr als 64 Zeichen nötig sind, wurde das sogenannte Computerbraille entwickelt, welches aus einem 8-Punktesystem besteht. Dadurch ergeben sich 256 Variationen von erstellbaren Zeichen.
Wie wird die Brailleschrift gedruckt?
Genau wie die Schwarzschrift kann die Brailleschrift heutzutage einfach auf Papier oder Karton gedruckt werden. In der Regel werden dafür sogenannte Punktschriftmaschinen verwendet. Diese bestehen aus insgesamt nur sechs beziehungsweise acht Tasten, die jeweils für einen Punkt im Raster stehen. Zusätzlich ist manchmal noch eine Leertaste vorhanden. Für die Prägung eines Buchstabens oder Zeichens müssen die entsprechenden Tasten im Akkord, also gleichzeitig, betätigt werden. Heute sind Punktschriftmaschinen in der Regel nicht mechanisch sondern digital, sodass das Geschriebene auf einem Medium gespeichert werden kann. Neben den Schriftmaschinen sind auch Schreibtafeln und Bandprägegeräte in Gebrauch.
Kann ich die Brailleschrift auf der ganzen Welt verwenden?
Im Jahr 1916 wurde zuerst die einheitliche englische Brailleschrift beschlossen. Andere Länder aus dem romanischen Sprachraum, die mit dem lateinischen Schreibsystem arbeiteten, zogen nach. Sprachspezifische Änderungen umfassen hauptsächlich bestimmte Umlaute oder Akzente, da diese von Sprache zu Sprache unterschiedlich sind. Länder, die zum Schreiben ihrer Sprache nicht die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets verwendeten, mussten grössere Anpassungen vornehmen. Sowohl in China als auch in den arabischen Ländern wird beispielsweise trotzdem das Braillesystem verwendet, sodass theoretisch untereinander kommuniziert werden kann. Selbstverständlich muss man dafür mit der jeweiligen Sprache und den Bedeutungen der Zeichenfolgen vertraut sein.
Auf welche Weise lernen blinde Menschen die Blindenschrift?
Es fällt insbesondere Kindern leicht, die Blindenschrift zu erlernen. Für diesen Zweck gibt es unter anderem Spielzeug und kinderfreundliche Schreibmaschinen sowie Kinderbücher, die ihnen die Blindenschrift und die dafür erforderliche Navigation der Finger spielerisch beibringen sollen. Blinden Kinder, die die Chance haben, eine Schule für Sehbehinderte zu besuchen, wird dort ebenfalls der Umgang mit der Blindenschrift gelehrt. Natürlich gibt es auch ein grosses Angebot an Lern- und Übungsmaterialien, welches Erwachsenen das Lernen der Blindenschrift erleichtern soll. Darüber hinaus bieten verschiedene Zentren für Blinde entsprechende Kurse an, die das Ziel haben, Erblindete in das gesellschaftliche Leben zu integrieren und daher auch die Blindenschrift in ihrem Programm anbieten.
Der Augenarztvergleich für die Schweiz. Finde die besten Augenärzte in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Augenärzte
Das könnte dich auch interessieren
Hornhautverletzungen – wichtige Information zu leichten und schweren Varianten
Hornhautverletzungen sind in den Augenkliniken an der Tagesordnung. Unabhängig von Alter und Geschlecht werden dort viele Patienten wegen dieses Leidens medizinisch versorgt. Fast immer sind Umwelteinflüsse, Unfälle oder eine Unachtsamkeit daran schuld. Selbst verursachte, durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkörper beigebrachte Verletzungen ziehen manchmal nur leicht verlaufende und ohne viel Aufwand zu heilende Hornhauterosionen nach sich. Kennst du die Symptome, kannst du beispielsweise mit Augentropfen sofort reagieren – bei dir und anderen. Das ist wichtig, denn eine Abklärung sollte unter keinen Umständen auf die lange Bank geschoben werden. Wissenswertes zum Thema Hornhautverletzungen gibt es hier.
Das Flimmerskotom ist ein belastendes Beschwerdebild bei Migräne
Das Flimmerskotom ist eine häufige Erscheinung, die im Zusammenhang mit einer Migräne auftritt. Das Augenflimmern muss jedoch kein zwingendes Symptom sein. Es gibt durchaus Patienten, die nicht unter diesen Sehstörungen leiden. Neben dieser Auffälligkeit treten bei der Erkrankung noch weitere Begleiterscheinungen auf, die insgesamt sehr unangenehm und für die Betroffenen äusserst quälend sind. In unserem Vergleichsportal erfährst du mehr Wissenswertes zu dieser Thematik und zu den Ursachen. Oftmals hilft eine gewisse Aufklärung über die Symptome, um diese Krankheit besser zu verstehen.
Verstecktes Schielen – die häufigste Form des Schielens kurz vorgestellt
Schielen ist eine offensichtliche Angelegenheit: Entweder man schielt oder nicht. So zumindest die allgemeine Meinung. Dabei gibt es eine Form des Schielens, die nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Das sogenannte versteckte Schielen betrifft einen Grossteil der Schweizer. Doch die meisten bemerken die Fehlstellung des Auges nicht, da sie keine Beschwerden haben. Was verstecktes Schielen ist, welche Beschwerden auftreten können und ab wann du zum Augenarzt gehen solltest, erfährst du in diesem Artikel.
Der Bindehautsack – Wissenswertes zu Ort, Funktion und Erkrankungen
Der Bindehautsack ist ein Hohlraum der Bindehaut. Dieser Hohlraum verfügt über eine sehr gute Resorptionsfähigkeit. Daher ist er ausgezeichnet für die Aufnahme von Medikamenten und Augentropfen geeignet. Auch ohne zu wissen, wo sich der Bindehautsack befindet, hast du wahrscheinlich schon mal Augentropfen über diesen Hohlraum eingenommen. In unserem Beitrag erfährst du alles Wichtige, das es hierüber zu wissen gilt.
Gesichtsfeldausfälle – wenn vorhandene Dinge plötzlich nicht mehr zu sehen sind
Gesichtsfeldausfälle sind eine Sehbehinderung, bei der ein- oder beidseitig Sektionen des Blickfeldes aus pathologischen Gründen ausfallen. Dabei kann es zur Wahrnehmung von Lichtblitzen kommen. Gewisse Bereiche erscheinen als schwarzer Punkt, auch blinder Fleck genannt, oder das Gesamtbild ist verschwommen, schemenhaft – abhängig vom Schweregrades des Skotoms. Das Gesichtsfeld beschreibt den für einen Menschen sichtbaren Bereich, wenn dieser, ohne den Kopf zu bewegen, frei geradeaus blickt. Unterschieden wird zwischen den degenerativen Gesichtsfeldeinschränkungen und Gesichtsfeldausfällen aufgrund einer Pathologie. Ein gesunder Mensch verfügt über ein Gesichtsfeld von rund 175 Grad. Dieser Wert sinkt mit zunehmendem Alter auf etwa 140 Grad.
Unscharfes Sehen – das kann die Ursache sein
Wenn sich die Sicht auf einmal trübt oder sich vor den Augen ein Schleier oder Nebel bildet, welcher das Erkennen der Umwelt erschwert, können verschiedene Sehstörungen und Erkrankungen der Auslöser sein. Manchmal tritt das unscharfe Sehen aber auch nur vorübergehend auf und hat keinen ernsthaften Hintergrund. So zeigen sich dunkle Punkte oder Schlieren, die bei den Augenbewegungen wegschwimmen, als harmlose Glaskörpertrübung.
