Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Epiretinale Fibroplasie: Definition, Diagnose und Behandlung
Was ist eine epiretinale Fibroplasie?
Die epiretinale Fibroplasie ist eine Häutchenbildung auf der Makula. Die Makula ist dabei eine Membran an der Netzhaut, die sich primär um die Sehschärfe kümmert. Bei einer epiretinalen Fibroplasie wird durch die Häutchenbildung die Netzhaut verzogen. Vergleichen kannst du dieses Verziehen mit Falten wie in einem Leintuch. Die Ursachen für diese Erkrankung sind unterschiedlich:
- Sie kann primär nach einer vorausgegangenen Augenkrankheit entstehen. Oft passiert dies altersbedingt durch eine Störung bei der Abhebung des Glaskörpers. Dieser Vorgang wird Glaskörperabhebung genannt.
- Auf sekundärer Basis nach Eingriffen am Auge, dazu gehört auch das Augenlasern, kann es ebenfalls zu dieser Erkrankung kommen.
Was ist eine epiretinale Gliose?
Bei der Gliose verformt sich der gesamte Glaskörper des Auges, wodurch die Makula mit einem sich bildenden Häutchen versehen wird. Diese Krankheit entsteht in der Regel erst bei Patienten über 50 Jahren. Die entstandene Membran durch das Häutchen reduziert das Sehvermögen und es kann zu Kurzsichtigkeit oder zur starken Abnahme der Sehfähigkeit kommen.
Welche Symptome gibt es bei einer epiretinalen Fibroplasie?
Erste Symptome bei einer epiretinalen Fibroplasie nimmst du beim Lesen wahr, weil die Linien der Buchstaben verzerrt werden. Zudem kann es sein, dass du in der Mitte deines Blickfeldes einen schwarzen Fleck, also nicht deine Umgebung, siehst. In einigen Fällen sind die Symptome jedoch auch kaum merklich und werden oft mit einer Weitsichtigkeit gleichgesetzt. Dabei kann es sich unter anderem um verschwommenes Sehen handeln.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
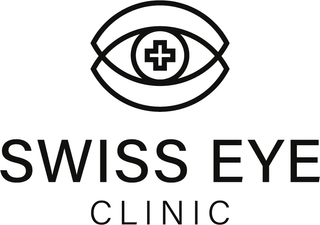 Zürich
ZürichSwiss Eye Clinic
Dufourstrasse 47, 8008 Zürich0 Bewetungen044 923 04 040449... Nummer anzeigen 044 923 04 04 * -
 Winterthur
WinterthurAugenzentrum Winterthur
Lagerhausstrasse 10, 8400 WinterthurAugenzentrum Winterthur wurde mit 3.7 von 5 Sternen bewertet3.73 Bewetungen052 213 38 000522... Nummer anzeigen 052 213 38 00 * -
Winterthur
Dr. med. Guber Ivo
Stadthausstrasse 51, 8400 WinterthurDr. med. Guber Ivo wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet53 Bewetungen052 213 70 500522... Nummer anzeigen 052 213 70 50 *
Wo befindet sich die Makula und welche Funktion hat sie?
Die Makula, auch gelber Fleck genannt, ist ein Bereich im hinteren zentralen Teil der Netzhaut des Auges. Durch diese verläuft die Sehachse, sodass sie zentral für die Sehfähigkeit gebraucht wird. Die Funktion dieses Teils des Körpers ist vor allem dazu da, dass du Objekte scharf sehen und fokussieren kannst. Das entspricht dem zentralen Gesichtsfeld, das durch die Schädigung der Makula fortschreitend verringert wird – deine Sehkraft schwindet.
Was passiert mit der Netzhaut bei einer epiretinalen Fibroplasie?
Die Netzhaut deines Auges beziehungsweise deiner Augen wird durch die Bildung des Häutchens an der Makula verformt. Es gibt dabei unterschiedliche Formen der Entwicklung.
- Schichtforamen: Für ein Schichtforamen muss noch keine Gliose stattgefunden haben. Es handelt sich dabei eher um einen Defekt der Makula an der Netzhaut. Dadurch schreitet die eigentliche Erkrankung langsam voran.
- Pseudoforamen: Durch die Verformung der Netzhaut entsteht bei diesem Krankheitsbild eine lochartige Form. Entsprechend verändert sich die Substanz der Netzhaut, sie wird jedoch nicht verdünnt. Daher trägt diese Erkrankung auch den Namen „Pseudo".
- Durchgreifendes Makulaforamen: Diese Krankheit ist mit einer Netzhautablösung zu vergleichen. Der Glaskörper zieht durch das entstandene Häutchen an der Makula, sodass das Gewebe zwischen dem Glaskörper und der Makula reisst. Diese Art schreitet sehr schnell fort, sodass du sie an einer schnellen Abnahme der Sehschärfe erkennst.
Wann kommt es bei einer epiretinalen Fibroplasie zur Operation?
Im Normalfall kann keine Art der epiretinalen Fibroplasie alleine abheilen. Eine Operation ist spätestens dann sinnvoll und angebracht, wenn du als betroffene Person im Alltag durch fehlende Sehschärfe stark eingeschränkt bist. Hast du jedoch nur wenige Symptome oder Schmerzen, wird der Krankheitsverlauf erst einmal beobachtet, bevor eine Operation infrage kommt. Generell orientieren sich Ärzte daran, erst zu operieren, wenn die Sehstärke auf unter 40 Prozent fällt. Das kann jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Die Operation selbst erfolgt meist in Vollnarkose auf stationärer Ebene oder ambulant mit einer lokalen Betäubung.
Welche Folgen hat eine epiretinale Fibroplasie für das Auge?
Wird eine epiretinale Fibroplasie durch eine Operation behandelt, werden die Verzerrungen, die durch die Krankheit entstehen, gemindert beziehungsweise verbessert. Inwieweit sich die Sehschärfe bessern kann, ist je nach Art der Fibroplasie und individuellen Eigenschaften unterschiedlich. Bei einer epiretinalen Fibroplasie liegt die Prognose bei einem Zugewinn der Sehkraft bei der Hälfte der bereits verlorenen. Wenn du dementsprechend 30 Prozent an Sehkraft verloren hast, können durch die Operation wieder 15 Prozent hinzugewonnen werden. Sowohl bei den Schichtforamen als auch bei den Makulaforamen lässt sich keine genaue Prognose stellen. Es geht hier eher darum, eine fortschreitende Verschlechterung zu minimieren. Bleibt eine epiretinale Fibroplasie unbehandelt, wirst du mit der Zeit stetig an Sehkraft verlieren. Deine Wahrnehmung wird verzerrt sein, sodass dir das Lesen und Erkennen von Symbolen und Buchstaben dadurch erschwert wird.
Der Augenarztvergleich für die Schweiz. Finde die besten Augenärzte in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Augenärzte
Das könnte dich auch interessieren
Nahakkomodation und Fernakkomodation – alles über die Flexibilität der Augenlinse
Damit du Gegenstände in unterschiedlicher Entfernung wahrnehmen kannst, muss dein Auge Nahakkommodation und Fernakkommodation beherrschen. Andernfalls würdest du immer nur Dinge in der gleichen Entfernung scharf sehen und der Rest der Welt wäre ein verschwommen. Doch wie schafft das Auge eine solch beeindruckende Leistung und welche Folgen können Störungen der Akkommodationsfähigkeit nach sich ziehen? Antworten auf diese und viele andere Fragen findest du hier.
Hornhautentzündung – nicht auf die leichte Schulter nehmen
Unsere Sehorgane nehmen eine Fülle an Reizen aus der Umwelt auf, über die wir uns orientieren. Deshalb ist eine gewisse Achtsamkeit geboten. Die Hornhautentzündung ist eine häufige Erkrankung der Augen. Sie hat mannigfaltige Ursachen und kann jeden betreffen. Allerdings gibt es zahlreiche Medikamente wie Augentropfen und operative Möglichkeiten, um die Keratitis, wie die Entzündung im Fachjargon heisst, zu bekämpfen. Eine grosse Menge an Wissenswertem über die Hornhautentzündung, deren Symptome und deren Behandlung erfährst du im folgenden Beitrag.
Augenkrebs: Wichtige Fragen und Antworten
Der Augenkrebs gehört zu den seltenen Formen der Krankheit. Tritt er jedoch auf, dann ist es von höchster Wichtigkeit, dass du so schnell wie möglich die passende Behandlung erhältst. Im folgenden Artikel erfährst du alles Wichtige zum Thema Augenkrebs – welche Arten es gibt, wie der Augenarzt ihn entdeckt und wie der Behandlungserfolg aussieht.
Lidrandentzündungen: nicht ansteckend, nicht gefährlich – aber ziemlich unangenehm
Rötungen, Schwellungen, klebrige Verkrustungen: Hinter diesen Symptomen kann sich eine Entzündung des Augenlids verbergen. Die weitverbreitete Erkrankung hat viele Ursachen und ist mehr als einfach nur lästig. Sie erhöht das Risiko für andere hartnäckige Augenleiden und kann das Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Mit einer konsequenten Therapie lassen sich die Beschwerden allerdings recht einfach in den Griff bekommen. Wir verraten dir, wie es überhaupt zu Lidrandentzündungen kommt, welche Methoden sich zur Behandlung eignen und was du tun kannst, wenn du ein entzündetes Augenlid hast.
Hornhauttransplantation – modernste Medizin für ein gutes Augenlicht
Die Hornhauttransplantation ist eine weniger bekannte chirurgische Massnahme. Sie ist eine verlässliche Therapie, die bei verschiedenen Augenerkrankungen Heilung bringt. Mittlerweile wird sie von zahlreichen renommierten Augenkliniken durchgeführt und ist, wie sich herausstellte, für Patienten weniger belastend, als ursprünglich angenommen wurde. Manchmal ist die Keratoplastik sogar die einzige Chance, wieder richtig sehen zu können. In unserem FAQ erfährst du eine Fülle an Wissenswertem und an Hintergrundfakten über die Operation, die als Keratoplastik bekannt ist, aber auch etwa zum Thema Hornhautbanken.
Hypophysenadenom – Ursache unbekannt, Behandlung möglich
Bestimmte Erkrankungen wie das Hypophysenadenom treten zwar selten auf, werden jedoch diagnostisch immer besser erschlossen. Trotzdem sind die Ursachen teilweise noch unbekannt. Mediziner gehen davon aus, dass die Erkrankung durch Hormonstörungen begünstigt wird und dann Sehstörungen und Kopfschmerzen hervorruft. Der damit verbundene gutartige Tumor in der Hirnanhangsdrüse ist durch eine Operation behandelbar. Alles Wissenswerte zum Hypophysenadenom gibt es hier.

