Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Die Okulomotoriusparese und ihre Auswirkungen auf das Sehvermögen
Was ist eine Okulomotoriusparese?
Bei der Okulomotoriusparese handelt es sich um die Lähmung (Parese) eines ganz bestimmten Hirnnervs, der Nervus oculomotorius genannt wird. Die Hirnnervenstörung ist eine sehr seltene Erkrankung und kann bei Männern und Frauen auftreten. Medizinisch unterscheidet man die Okulomotoriuslähmung in eine innere und äussere, wobei die dazugehörige Lähmung entweder einseitig oder auf beiden Augen in Erscheinung tritt. Sie kann teilweise oder komplett entstehen sowie äussere und innere Augenmuskeln betreffen. Die Aussicht auf Heilung hängt stark von der zugrundeliegenden Erkrankung selbst ab und davon, wie sich die Auswirkung der Parese an den Augen zeigt. Schwieriger ist die Prognose, wenn die Ursache Tumore, Aneurysmen oder ein Trauma sind. Hier kommt es zu weitreichenden Folgen und Sehfähigkeitseinschränkungen, gleichzeitig auch zu schwerwiegenderen Nervenschäden.
Welche Funktion hat der Nervus oculomotorius?
Der Nervus oculomotorius ist der dritte Hirnnerv und entspringt dem vorderen Mittelhirn. Er hat einen grossen Anteil an der Funktion der motorischen Fasern und äusseren Augenmuskeln im Auge. Er beeinflusst vier der sechs äusseren Augenmuskeln und den Muskel für das Augenlidanheben. Auch zwei wichtige der inneren Augenmuskeln werden über den Hirnnerv angeregt. Tritt am Nervus oculomotorius eine Störung auf, entstehen komplexe Beeinträchtigungen am Auge, die grösstenteils dessen Beweglichkeit und Wahrnehmung betreffen.
Wie äussert sich die Lähmung der Augenmuskeln?
Die Okulomotoriuslähmung zeigt sich in einer weit geöffneten Pupille und in einer dazugehörigen Pupillenstarre. Diese kann einseitig oder auch beidseitig auftreten und das Sehvermögen stark einschränken. Betroffenen ist nicht mehr möglich, Objekte deutlich aus der Nähe wahrzunehmen oder von der Distanz auf eine Naheinstellung umzuschalten. Die Erkrankung löst entsprechend eine Störung bei der Akkommodation des Auges aus. Sie ist durch die unterschiedliche Augenstellung auch im Gesicht erkennbar. Die Erkrankung verursacht Augenmuskelgleichgewichtstörungen, die sich als Schielen äussern. Auch die Diplopie, das Wahrnehmen von Doppelbildern, gehört dazu, während das obere Augenlid stärker herabhängt.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
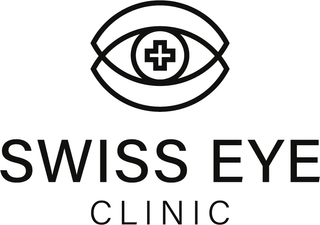 Zürich
ZürichSwiss Eye Clinic
Dufourstrasse 47, 8008 Zürich0 Bewetungen0449... Nummer anzeigen 044 923 04 04 * -
 Zürich
ZürichVista Augenklinik Seefeld
Holbeinstrasse 25, 8008 Zürich0 Bewetungen0442... Nummer anzeigen 044 266 60 90 -
 Zürich
ZürichVista Augenpraxis Talwiesen
Birmensdorferstrasse 318, 8055 Zürich0 Bewetungen0444... Nummer anzeigen 044 463 63 63
Welche Symptome und Beschwerden treten auf?
Die Parese zeigt sich in typischen Symptomen, die bei fast allen Menschen ähnlich verlaufen. Die Pupille ist durch die Lähmung erweitert, die Augen schielen und ein Augenlid hängt herab (Ptosis). Weitere Symptome sind:
- Doppelbilder
- verschwommene und verzerrte Sicht
- Bewegungseinschränkungen des Auges
- Ausfall der Akkommodation
Welche Ursachen kann die Okulomotoriuslähmung haben?
Die Schädigung der Hirnnerven hat verschiedene Auswirkungen auf den Körper. Ebenso sind die Ursachen für eine Okulomotoriuslähmung vielseitig, wobei auch Erkrankungen dazugehören, die Aneurysmen auslösen. Dazu gehören das Clivuskanten- und Sinus-Cavernosus-Syndrom. Beeinträchtigungen direkt am Hirnnerv haben Ursachen wie:
- Durchblutungsstörungen
- Tumore im Hirnstamm
- Schädigungen in Gehirn und Auge
- Traumata
- Ausfall mehrerer Hirnnerven
- Diabetes mellitus
Wie wird die Erkrankung in der Neurologie behandelt?
Weil es sich bei der Okulomotoiusparese um eine neurologische Störung handelt, findet die Therapie und Ursachenklärung in der Neurologie statt. Es ist wichtig, dass du immer einen Arzt aufsuchst, wenn Auffälligkeiten am Auge auftreten, die auch das Sehvermögen beeinträchtigen. Wenn du merkst, dass du deine Umwelt nicht mehr scharf erkennst oder anfängst, doppelte Bilder zu sehen, ist eine Bestimmung der Ursachen wichtig. Das gilt natürlich auch, wenn du deine Augenmuskeln nur noch eingeschränkt nutzen und entsprechend bestimmte Bewegungen nicht mehr ausreichend ausführen kannst.
Die Ursachenklärung und Behandlung verläuft beim Arzt in der Neurologie mit verschiedenen diagnostischen Mitteln. Dabei spielt die Überprüfung der Blickrichtung eine Rolle, die wichtig ist, um die Auswirkung der Parese einzuschätzen und um herauszufinden, welche Bereiche betroffen sind. Der Neurologe testet bei dir, inwieweit du in der Lage bist, den typischen acht Blickrichtungen zu folgen. Du wirst dann aufgefordert, auf den Finger oder Kugelschreiber deines Arztes blicken und seiner Bewegung folgen, ohne selbst die Kopfrichtung zu verändern. Treten Störungen auf, lässt sich der Bereich leichter einschränken und herausfinden, welcher Nerv betroffen ist.
Welche Komplikationen können bei einer Parese auftreten?
Bei dieser Erkrankung ist einer der wichtigsten Nerven für die Bewegung der Augenmuskeln betroffen. Das kann zu weiteren Komplikationen führen, sogar wenn die Ursache bereits geklärt ist. Oft tritt die Okulomotoriuslähmung mit anderen Erkrankungen gemeinsam auf, er ist aber auch ein isoliertes Krankheitsbild mit Bewegungsausfällen des Auges.
Komplikationen entstehen, wenn zum Beispiel ein Tumor oder Aneurysmen die Ursache sind. Diese drücken dann stark auf den Nerv und bewirken weitere Veränderungen, weil es sich um raumfordernde Prozesse im Auge und im Körper handelt. Das kann auch dann lebensbedrohlich werden, wenn bereits eine Behandlung erfolgt ist. Die Beschädigung am Augenbewegungsnerv ist in ihrer Auswirkung nur schwierig einzuschätzen und benötigt weitere Nachbehandlungen. Sind die Ursache Durchblutungsstörungen, sind auch die Heilungschancen besser. Lassen die Beschwerden nicht nach, hilft manchmal eine Schieloperation, um das Sehfeld wieder zu normalisieren.
Der Augenarztvergleich für die Schweiz. Finde die besten Augenärzte in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Augenärzte
Das könnte dich auch interessieren
Auge zugeschwollen – was kann ich tun?
Das menschliche Auge ist empfindlich. Eine einfache Allergie kann genauso gut geschwollene Augen auslösen wie trockene Augen, ein Gerstenkorn, verschiedene körperliche Erkrankungen oder Entzündungen. Je nachdem, wo das Auge eine Schwellung zeigt, ist die Ursachenklärung beim Augenarzt auf verschiedene Art und Weise möglich. Oft zeigen sich geschwollene Augen aber auch morgens nach dem Aufstehen oder bei Kummer und Tränen.
Grosse Pupillen können unterschiedliche Ursachen haben
Landläufig herrscht die Meinung vor, wer grosse Pupillen habe, hätte illegale Substanzen zu sich genommen. Häufig trifft dies auch zu. Drogen- oder Medikamentenmissbrauch ist die häufigste Ursache für grosse Pupillen – bei weitem aber nicht die einzige. Im Mittelalter galten grosse Pupillen bei Frauen als besonders schön. Sie träufelten sich vor einem Rendezvous aus diesem Grund Saft aus Tollkirschen, das Atropin enthält, in die Augen. Viele spannende Fragen rund um das Thema grosse Pupillen beantworten wir hier.
Kataraktoperationen gegen Grauen Star – Fragen und Antworten
Ein „Katarakt“ oder „Grauer Star“ beschreibt die Trübung der Augenlinse. Wenn sich die Linse des Auges eintrübt, dann nimmt die Sehleistung ab und die Person sieht wie durch einen grauen Schleier. Mithilfe von Kataraktoperationen lässt sich die Sehfähigkeit der Augenlinse gänzlich oder zumindest beinahe wiederherstellen. Alles zum Thema erfährst du in unserem hilfreichen FAQ.
Bindehautentzündung Ansteckungsgefahr: So kann sie minimiert werden
Bindehautentzündung und Ansteckungsgefahr: Ein wichtiges Thema für Betroffene einer Konjunktivitis. Treten die ersten Symptome einer Bindehautentzündung auf, sollte das Risiko einer Ansteckung nicht unterschätzt werden, damit Angehörige, Freunde und Kollegen geschützt sind. Erfahre im folgenden Ratgeber, wie gross die Bindehautentzündung-Ansteckungsgefahr ist, wie sich die Entzündung der Bindehaut überträgt und welche Massnahmen du ergreifen kannst, um das Risiko zu minimieren.
Sehnerventzündung – Fragen und Antworten
Verschlechtert sich von einem Tag auf den anderen plötzlich die Sehkraft und alles scheint wie hinter einem Schleier zu sein, liegt vermutlich eine Entzündung des Sehnervs vor. Da diese sich in vielen Fällen nicht ohne weiteres von allein wieder zurückentwickelt, ist eine ärztliche Untersuchung und eine medizinische Behandlung unerlässlich. Hier erfährst du, wodurch eine Sehnerventzündung ausgelöst wird, mit welchen Symptomen sie einhergeht und wie die Behandlung aussieht.
Eine Glaskörperablösung ist keine Bagatelle
Glaskörperablösungen oder Glaskörperabhebungen sind Erkrankungen der Augen, die unter Umständen böse enden können. Denn ihnen folgen Beeinträchtigungen an anderen Augenstrukturen wie etwa der Netzhaut. Bei einer Glaskörperablösung ist nicht auszuschliessen, dass sich zuvor ein Netzhautriss eingestellt hat, der aus der Beschädigung von einzelnen Netzhautteilen resultiert. Eine Netzhautuntersuchung ist daher gerade bei Kurzsichtigkeit obligatorisch, um schwere Schäden zu vermeiden. Die gute Nachricht: Eine zeitnahe Operation verhindert meist eine Erblindung. Erfahre hier mehr über die Gefahren einer Glaskörperablösung und wie die Augenheilkunde dagegen vorgeht.
